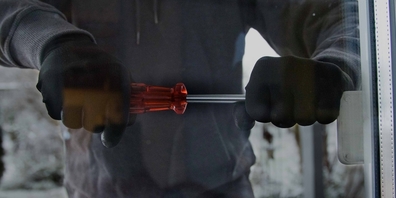Sie ist klein und unscheinbar und war bis vor wenigen Jahrzehnten eine häufige Bewohnerin offener Agrarlandschaften: die Feldlerche. Die Naturschutzorganisation BirdLife Schweiz kürte sie unlängst zum «Vogel des Jahres 2022». Unverkennbar ist der jubilierende und fast pausenlose Gesang der Männchen, wenn sie im Frühling minutenlang über Feldern und Wiesen flattern und so versuchen ein Weibchen zu gewinnen. Doch dieses einst so alltägliche Schauspiel lässt sich hierzulande immer seltener beobachten. In den vergangenen 30 Jahren ist ihr Bestand im Mittelland gemäss BirdLife um über die Hälfte geschrumpft – im Kanton Zürich sogar um über 90 Prozent.
Rückgang auch in Bezirk March und Höfe
«Die Situation sieht nicht gut aus», erklärt Kuno Jäggi, Präsident von BirdLife Freienbach. Im Bezirk Höfe gebe es seines Wissens keine Feldlerchen mehr. «Zum letzten Mal habe ich eine in der Schwantenau gesehen», fügt er an. Dies sei mehr als ein Jahr her. Seine Befürchtung decke sich mit der Beobachtung zweier Ornithologinnen aus Lachen. Der Frauenwinkel bei Hurden wäre theoretisch ein geeigneter Lebensraum für Feldlerchen – doch auch da sind keine mehr zu finden. Laut Kuno Jäggi sind die Gründe dafür unklar. Armin Hegner, Ehrenpräsident von BirdLife Siebnen kann den Rückgang der Feldlerchenpopulation auch in der March bestätigen. Ganz vereinzelt gebe es sie noch am Wangner Horn.
Intensive Nutzung als Bedrohung
Das Verschwinden des musikalischen Vogels geht gemäss BirdLife Schweiz auf die zunehmende Industrialisierung der modernen Landwirtschaft zurück. Die intensive Nutzung von Wiesen und Äckern bedroht die Feldlerche auf zwei Arten. Der Vogel ist laut Armin Hegner ein sogenannter Bodenbrüter,das heisst, er legt seine Eier auf dem Boden von Kulturland ab. Zwar brütet die Feldlerche relativ früh, bereits im April, und es dauert nur rund 12 Tage bis die Jungen schlüpfen. Nach weiteren sieben bis 12 Tagen sind die Jungvögel bereits flügge und verlassen das Nest. Dies ist Rekord unter den heimischen Singvögeln. Aber auch Rekordtempo hilft nichts im Rennen um einen sicheren Brutplatz. Denn bereits im April werden erste Wiesen gemäht und so die Gelege zerstört.
Weniger Biodiversität – weniger Nahrung
Aber nicht nur ein früher Heuschnitt, auch das regelmässige Ausbringen von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln auf Wiesen und Ackerflächen bedroht laut Kuno Jäggi die Feldlerche. Denn mit der intensiven Düngung nimmt auch die Biodiversität der Kulturlandschaft ab. Blühende Ackerbegleitflora als Nahrungsquelle für Insekten verschwindet zunehmend. Pestizide machen den Krabbeltieren zusätzlich den Garaus. Die Folge davon: Es gibt weniger Nahrung für Insektenfresser wie die Feldlerche.
Umdenken ist gefragt
Um dem fortschreitenden Verschwinden des einstigen Allerweltsvogels entgegenzuwirken, müssten die Kulturflächen ökologisch nachhaltiger genutzt werden. Das heisst in der Praxis: weniger oft mähen, weniger düngen, weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Hier sind die Landwirtinnen und Landwirte gefragt. «Es sind bislang leider nur wenige bereit, auf biologischökologische Anbaumethoden zurückzugreifen », bedauert Kuno Jäggi. «Es gilt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.» Ihm sei bewusst, dass ein solcher Umstieg nicht einfach sei. Denn schliesslich müssen die Beteiligten davon leben können.
Zusammenarbeit von Biodiversität und Landwirtschaft
Dem stimmt Armin Hegner zu, der auch Landwirte in ökologischen Fragen berät. Förderung der Biodiversität gelinge nur in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Auch diese würde am Ende von mehr Biodiversität und besserer Bodenqualität profitieren. Und die Projekte müssten grossflächig sein – auch wenn kleine Förderprojekte durchaus sinnvoll seien.