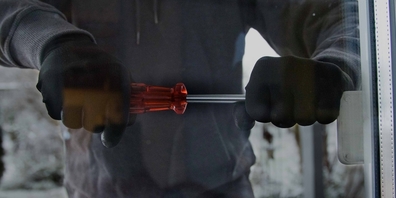Sagen – ein bedeutendes kulturelles Erbe


Mündlich überlieferte Erzählungen werden im Allgemeinen unter dem Begriff «Sagen» zusammengefasst. Aus der Sprachanwendung «Man sagt, …» – «Es wird gesagt, …» hat sich der Ausdruck auf natürliche und nachvollziehbare Weise gebildet. Ein grosser Teil der Sagen stammt denn auch aus Zeiten, wo nur wenige Menschen des Lesens und Schreibens mächtig waren und damit Überlieferungen schriftlich empfangen und weitergeben konnten. Das gesprochene Wort allein war Mittel zur Überlieferung von Ereignissen aus ferner Vergangenheit.
Zu Anfang dürfte eine Sage wohl nichts anderes als die persönliche Schilderung eines Erlebnisses gewesen sein. Durch die ständig weitergegebene Überlieferung aber entsteht mit der Zeit ein Fabulat, das zum Grundsätzlichen übergeht und wie ein Bericht verfasst ist.
In der Tradition1 – in der Überlieferung – sind Sagen mithin nicht nur Abbild oder Ausdruck eines Zeitpunkts, sondern ebenso Sinnbild einer stark erweiterten Zeitspanne in der Vergangenheit.
Zur Unterscheidung von Sagen, Märchen, Legenden und Mythen
Sagen stehen für volkstümliche Geschichten, die häufig einen historischen Kern aufweisen. Zu ihr gehört eine klare Aus-sageabsicht, die in der Zeit ihrer Aktualität verstanden wurde, heute aber womöglich nicht mehr einfach nachvollziehbar ist, da sich die Lebens- und Denkgewohnheiten der Menschen über die Jahrhunderte ständig verändert haben. Hinzu kommt, dass Sagen im Zeitenlauf um ein Vielfaches ausgeschmückt und umgestaltet wurden. Anders als die Märchen sind Sagen stets eng verbunden mit einem Ort, einer Region sowie mit einer strengen Scheidung zwischen dies- und jenseitigem Bereich.
Die Märchen sind eine eigentliche Literaturgattung von zumeist kurzen Erzählungen, ausgeschmückt mit übersinnlichen und wunderbaren Elementen. Da sie in der Regel nicht einem Ort oder einer Region zugeordnet werden können und damit frei sind von lokalen Bindungen, wirken sie in erster Linie durch eine allgemeingültige Botschaft.
Anders auch als die Sage ist die Legende ein Bericht über ein Ereignis, der zur frommen Erbauung des Lesers erfasst und wiedergegeben wird. Ganz ursprünglich aber beschrieben Legenden das Leben von Heiligen. Allerdings ist die Abgrenzung von Sage und Legende in der Forschung umstritten. Während in der Sage das Auftreten des Wunderbaren den verschiedensten Mächten – Teufel, Dämonen, Zwergen, Hexen – zugeschrieben wird, bewirken dies in der Legende immer der christliche Gott, Engel oder Heilige. Die Legende wird damit zum Zeugnis naiven Volksglaubens und erfüllt die belehrende Funktion innerhalb der kirchlichen Überlieferung zur Festigung der Volksfrömmigkeit und der Heiligen-verehrung, während die Sage oft dem Aberglauben zugeordnet wird, obwohl auch sie christlich überformt sein kann.
Bei den Mythen handelt es sich um eher kollektive gesellschaftliche Sichtweisen oder Weltanschauungen einer ganzen Volksgemeinschaft unter Verwendung von religiösen Symbolen und Gleichnissen. Von der Sage im engeren Sinn unterscheiden sie sich durch komplexe dichterische Form, die sich ebenfalls sagenhafter und mythologischer Stoffe bedient. Zu den Mythen sind etwa die antiken Göttersagen zu zählen, die Heldenlieder und auch die skandinavischen Sagas.

Sagen in der Farbe der Landschaft
Die Volkssage in ihrer frei geschaffenen Gestalt ist vor Erweiterung und Verstümmelung ebenso wenig geschützt, wie sie auch nicht am Ort ihrer Entstehung haften bleibt. An ihrem Wesen aber ändert sich dadurch an sich nicht viel, da sie die Farbe der Landschaft und die Eigenart des Menschenschlags annimmt und damit Heimatrecht in verschiedenen Gegenden erlangt. Zu dieser Gattung gehören insbesondere die sogenannten Wander-sagen, die auch in der Überlieferung unserer Region häufig anzutreffen sind. Wenige Beispiele mögen die Erscheinung verdeutlichen: Allgemein menschlich ist der Glaube an Wassergeister. In ihrer Grausamkeit, Menschen anzulocken und in die Tiefe zu ziehen, lebt vielleicht eine leise Erinnerung an alte, grausame Menschenopfer weiter. Alt auch ist die Vorstellung vom wütenden Heer, das im Sturm daherbraust und unter christlichem Einfluss teuflischen Charakter erhalten hat, ebenso der Totenzug. Die Schlangenjungfrau, wie auch die Vorstellung der gekrönten Schlange, dürfte keltischen Ursprungs sein.
Berg- und Waldgeister in den Volkssagen spiegeln stets auch den Eindruck der wilden Waldnatur auf das Gemüt des Menschen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie an verdrängte Ureinwohner des Landes erinnern. In späteren Sagen wird ihre Einfalt, Plump- und Dummheit wie auch ihre Überlistung durch den Menschen manchenorts auf den Teufel übertragen; es sind vielfach Erklärungssagen, welche die Herkunft einzelner Felsblöcke und Naturphänomene als Riesenwerk deuten. Auch die verschiedenen Erscheinungsformen der Zwerge als Berg- und Wildleute, Schratte und Kobolde entstammen zum Teil Naturerlebnissen. Mit ihnen haben sich oft der Glaube an das Fortleben der Toten und späterer Teufelsglaube vermischt. Ebenso geht die Vorstellung von den weissen Frauen in ihren Ursprüngen teils auf Naturvorgänge wie Nebel- und Lichterscheinungen, teils aber auch auf den Seelenglauben und Märchenmotive zurück.
Wurzeln und Ursprünge
Der Glaube der Zuhörer an die Wirklichkeit der erzählten Inhalte der Sage verlieh ihr – neben der örtlichen und zeitlichen Gebundenheit – verstärkten Halt. Die mythische Sage forderte ganz besonders unbedingten Glauben, umso mehr, als -diese Gattung in vielen Fällen geradezu die Beispiele für die Wirklichkeit und Wahrheit des Volksglaubens zu erbringen hatte. Wir wissen, dass der Volksglaube und die übersinnlichen Vorstellungen in Sage und Märchen eine ältere, einfachere Art mythischer Dichtung darstellen, die in ihren Wurzeln eigentliche Volksdichtung sind. Aus dem tiefen Untergrund des Volkstums entsprossen, saugen diese Sagen daraus stets neuen Saft und verjüngen sich. Doch reichen keineswegs alle mythischen Sagen in das Heidentum zurück; die bildende Fantasie schafft solche fortzeugend und immer wieder aufs Neue.
Dämonische Mächte bis zu Erklärungssagen
Schratte oder Schrättlige beispielsweise sind Quälgeister, die auf Erfahrungen des Traumes zurückgehen. Sie setzen sich dem Schlafenden auf die Brust, drücken und würgen ihn, dass er schweissgebadet und matt erwacht. Oft entledigt sich der Träumende der beängstigenden Last dieses Albdrucks durch einen heftigen Ruck, einen Aufschrei, der ihn aus dem Schlaf weckt und das Gespenst verscheucht. Daraus schliesst die Sage, dass der Albdruck oder Angsttraum entflieht, sobald er mit Namen genannt wird. Mit dem Bekanntwerden des Namens verliert dessen Träger seine dämonische Macht. Durch die Benennung werden auch andere Unholde, Geister, Hexen und der Teufel verscheucht. Ebenso verschwinden die Wundergaben wie etwa das goldene Blatt oder die Kohle, die zu Gold wird, sobald Vorwitz oder Ungeduld nach dem Woher der wunderbaren Erscheinung zu grübeln beginnt.
Zu den ätiologischen Sagen mit ihrer Lehre von den Ursachen im weiteren Sinn gehören auch die von grossen Freveln und ihrer Strafe, denn in diesen handelt es sich meistens um die fantasievolle Erklärung von Naturerscheinungen: Was mag an Stellen, die heute von Wassermassen bedeckt sind, einst vorgegangen sein? Wie sind das Vorhandensein ausgedehnter Schneefelder und Gletscher oder die Schuttmassen von verheerenden Bergstürzen und Lawinen zu erklären? Was bedeuten die Felsen, in denen die Fantasie menschliche Gestalten zu erblicken glaubt? Die Sage ist geneigt, in ihnen die Spuren göttlicher Strafgerichte für sündhaften Übermut oder Herzlosigkeit der früheren Geschlechter zu erblicken. Wo der Pflug Mauerreste und andere Zeugen alter Ansiedlungen zutage fördert, da muss einst eine Stadt gestanden haben, deren Bewohner den Zorn Gottes herausforderten. Frevler aller Art werden auf der Stelle zu Stein. Eine sündhafte Stadt, das Dorf, wo lauter Hartherzige wohnten, sind von den Fluten verschlun-gen worden. Hoch in den Bergen tritt anstelle des Wassers das Eis des Gletschers. Was solchen Sagen im Volk eine starke Wirkung sichert, ist, dass sie an die Stätte der Öde und Verlassenheit früheren Reichtum und Wohlstand setzen und von einem goldenen Zeitalter erzählen, das die Menschen durch eigene Schuld verscherzt haben.
Sagen in der Region
Wenn das umfangreiche und durch Alois Senti und weitere Autoren weitgehend aufgearbeitete Sagengut des südlichsten Kantonsteils umfassend erforscht ist, sodass das Sarganserland heute als eigentliches Sagenland gilt, darf nicht vergessen werden, dass auch die nördlich angrenzende Region Werdenberg diesbezüglich auf einen reichen und oft unterschätzten Fundus zurückgreifen kann.
Es bedarf aber enormer Arbeit, diesen in vielen literarischen Erzeugnissen verstreuten Schatz zusammenzutragen. Der Autor dieses Beitrags beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Anlage einer geordneten werdenbergischen Sagensammlung und hat es sich zum Ziel gesetzt, das umfangreiche Material in absehbarer Zeit in einer Publikation einer in-teressierten Leserschaft zur Verfügung zu stellen. (sl)

Fantasie und Erscheinungen
In Gegenden mit altem Bergbau treten häufig die Sagen von den Venedigern auf. Die reichen Metallschätze, wie etwa das Eisen im Gonzen, lockten viele Ausländer ins Land. Auf der andern Seite ist nicht zu verkennen, dass sie im Volksmund schon frühzeitig durch Züge aus den Geschichten vom Teufel und den Schwarzkünstlern bereichert wurden. Doch meist sind es die Erscheinungen in der freien Natur, die den Menschen zum Nachdenken reizen, seine Fantasie beschäftigen und Sagen bildend wirken. In dem Wildwasser, das aus unzugänglichen Schluchten hervorbricht, den Anwohnern Verderben und Vernichtung bringt, sieht die Volksfantasie ein schlangenartiges Untier. Durch fantastische Vergrösserung erwächst aus dem Bild der Drache oder Lindwurm. Im abgelegenen Gebiet lauert er auf seine Beute; wenn er erwacht, stürzt sich der Berg verheerend über menschliche Ansiedlungen.
Reizvolle Verbindung von Motiven
Hinwieder sind es Erscheinungen im menschlichen Leben – Schlaf, Traum und Tod –, auf deren primitiver Deutung die vielen Sagen von den Seelen verwunschener und auf Erlösung harrender Menschen, den Schatz- und Spukgeistern, beruhen. Es bleibt aber in der Sage fast nie bei der Erfindung einfacher Motive, sondern diese werden zueinander in mannigfache und reizvolle Verbindung gesetzt. Das Volk hat an gewissen Vorstellungen besondere Freude und leitet sich gegenüber dem Sagengut das Recht ab, sie nach freier Wahl zu immer neuen Gebilden zu verschmelzen, sie gegenseitig zu durchkreuzen; es betätigt damit seine freie Schaffenslust. In vielen Sagen harrt eine verwunschene Seele, eine zur Schlange verwandelte Jungfrau oder sonst ein unseliger Geist auf Er-lösung; sie kann ihnen durch fromme Werke oder eine mutige Tat zuteilwerden. Wenn aber der Versuch gescheitert ist, klagt die Seele häufig, sie könne nun erst erlöst werden durch ein Kind, das in der Wiege liege, die aus dem Holz eines bestimmten, erst in weiter Zeitenferne aufspriessenden Baumes gefertigt werden soll. Dieses Motiv hat sich in viele Sagen gedrängt; es entstammt der Erzählung des Nikodemus-evangeliums2, wonach Adam in der Vorhölle jubelt, als seine an das Aufwachsen des Baumes geknüpfte Erlösung sich vollziehen soll.

Verdunkelte Tatsachen
Etwas schwieriger fällt es, die ursprünglichen Motive aufzufinden, wenn die Sage historische Vorgänge und Personen behandelt. Irgendein Geschehnis, das in der Erinnerung des Volkes haftet, dessen tie-fere Ursachen aber unbekannt geblieben oder vergessen sind, regt seine Fantasie zu einem Wiedererschaffen der wirklichen Geschichte in der Sage an. Je länger diese lebt, je weiter sie sich von der Zeit und dem Schauplatz des historischen Geschehnisses entfernt, desto mehr tritt in ihr die Erinnerung an die Verhältnisse und Personen zurück, desto freier wird der überkommene Stoff vom Dichter gehandhabt, desto mehr dringt das Typische, Poetische in den Vordergrund und verdunkelt die Tatsachen. Der geschichtlichen Sage aber fehlt meist die objektive Wahrheit; sie ist als Geschichtsquelle deshalb kaum brauchbar.
Für kleinere Geschichten – die Taten beherzter Männer und Frauen, ausserordentliche Erlebnisse und Schicksale von Menschen – geben bedeutende weltgeschichtliche Ereignisse einen prächtigen Hintergrund ab. Schwere Bedrängnisse, wie die Zeit der französischen Durchzüge und Besetzung von 1798 bis 1813, hinterlassen tiefe Spuren im Gedächtnis des Volkes, sodass frühere und spätere Überlieferungen gern in solch bedeutsame Zeiten verlegt werden.
Wie im Volkslied, so bemerkt man auch in der Sage, dass das Volk in seiner Vorliebe für das Ausserordentliche mitunter offen für Leute Partei ergreift, welche die menschliche Gesellschaftsordnung übertreten: kühne Räuber und geniale Betrüger, und häufig besitzen diese gefährlichen Gesellen vermeintlich die Gabe der Zauberei.
Alte Vorstellungen, gemeinsames Gut
Heute ist die Sagenkunde ein Teil der Volkskunde. In der Sage spiegelt sich die geistige Welt des Volkes, aus der sich die alten Vorstellungen und Anschauungen immer lebendig und wirksam erhalten. Soweit es sich zurückverfolgen lässt, berühren sich die Volksstämme, die am Alpenrhein leben, seit jeher eng. Dadurch wird wie in vielen kulturellen Belangen auch im Sagenschatz allerhand gemeinsames Gut bewahrt. Ein grosser Teil der Sagenmotive unserer Region findet sich demzufolge nicht nur im benachbarten Bündnerland; sie reichen über den süddeutschen Raum und das Vorarlberg ins Tirol, partiell über Südtirol und Kärnten bis ins rumänische Siebenbürgen. Und etliche «unserer» Sagen gründen ferner in ihrem Kern tief in der germanischen Mythologie oder enthalten Elemente aus den Sagas des Nordens: Die Verbreitung auch dieser vielgestaltigen Sagenstoffe ist mit Blütensamen vergleichbar, die vom Wind der Zeiten verweht wurden und irgendwo wieder aufgekeimt sind.

Anmerkungen
1) Der Begriff Tradition (von lateinisch tradere‚ «hinübergeben», traditio «Übergabe», «Auslieferung», «Überlieferung») bezeichnet nicht nur die Weitergabe von Handlungsmustern wie beispielsweise das Brauchtum, sondern auch die mündliche oder schriftliche Überlieferung von Überzeugungen und Glaubensvorstellungen.
2) Die seit dem Mittelalter als Nikodemusevangelium bezeichneten «Pilatusakten» enthalten Ausschmückungen um den Prozess, die Grablegung und die Auferstehung Jesu mit der Tendenz, die Figur des
Pilatus von der Verantwortung für den Tod Jesu zu entlasten.
Literatur
– Historisches Lexikon der Schweiz: Sagen und Legen-den. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D11302.php.
– Lienert 1911: Lienert, Meinrad, Schweizer Sagen und Heldengeschichten. Illustrationen von Wilhelm Roegge. Stuttgart und Olten 1911.
– Musäus 1842: Musäus, Johann Karl August, Volksmärchen der Deutschen. Reprint Zürich o.J.
– Sagen.at: Datenbank zur Europäischen Ethnologie/Volkskunde, in: www.sagen.at.
– Sagenwelt: Alles, was die Schweiz hat, in: brauchtum schweiz.ch.