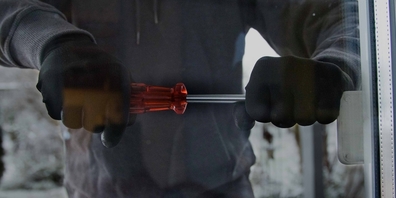Kulturlandschaft Porta Romana


Porta Romana – der Name weist ohne Umschweife auf die Römerzeit hin. Während Jahrhunderten gebärdete sich der junge Rhein als wild mäandernder, unberechenbarer Geselle und überschwemmte regelmässig das Churer Rheintal. Bis in die Siedlungszentren von Magia, dem heutigen Maienfeld, und von Ragaz reichten seine reissenden Fluten. Zur Erreichung der norditalienischen Märkte umgingen deshalb Handel und Reisende diese Gefahr für Leib und Gut und beschritten den uralten Handelsweg der Porta Romana.
Porta Romana heisst noch heute ein steiler Weg, der sich in Bad Ragaz vom Eingang zur Fluppi am Südhang des Wartensteins emporwindet. Die Porta Romana führte via Pfäfers über Vadura (via dura, d. h. harter Weg) ins innere Taminatal und über Vättis und den Kunkelspass nach Tamins den Bündner Pässen Lukmanier und Septimer zu. Jenseits des Kun-kels-pas-ses trennte sich der Weg in zwei: Der eine führte über das Domleschg ins Albulatal und in den Oberhalbstein zum Julierpass, der andere westwärts, dem Vorderrhein entgegen, nach dem Lukmanier- und dem Oberalppass. Länge und Beschwerlichkeit des Saumweges führten oft dazu, dass an nützlicher Stelle ein Hospiz errichtet wurde. Dies gehörte im Mit-tel-al-ter zu den Aufgaben der Klöster. Von den Hospizmönchen und Hilfskräften wurde auch der Passweg instand gehalten. Das Hos-piz wurde Fabarias genannt, aus welchem sich der Ortsname Pfäfers entwickelte.
Sperren, Schanzen, Burgen
Alte militärische Karten zeigen auf der Talseite der heutigen Bündner Herrschaft an strategisch wichtigen Stellen zwischen Fläsch, der Luzisteig, Malans und Landquart zahlreiche Fortifikationen, Schanzen und Sperren, welche zur Römerzeit errichtet und später ergänzt, geschliffen oder aber dem Verfall preisgegeben wurden. Auf der gegenüberliegenden Talseite liess Abt Konrad II. an der Bergflanke, welche einst eine dieser römischen Sperren aufwies, zum Schutz des Passwegs und der Bauherrin, der Benediktinerabtei Pfäfers, 1206 auf einem Felssporn die Burg Wartenstein errichten.
Es lohnt sich, einen Blick auf die bewegte Geschichte von Wartenstein zu werfen. Da die Autorität des Heiligen Römischen Reiches erlahmte, bedurften die meisten und vor allem die kleineren Klöster eines weltlichen Schirmvogtes. Diese Rolle übernahmen die Freiherren von Sax. Sobald die Burg wohnlich eingerichtet war, behielt sie der Meier (Gutsverwalter der Abtei Pfäfers), auf dessen Anregung Konrad II. tätig geworden war, für sich. Diese und andere Eigenmächtigkeiten ergrimmten den Kastvogt von Wartenstein, Albert von Sax. Er lockte den Meier aus Wartenstein, beliess ihn über Jahre in Sax im Kerker und zog, von Kaiser Otto mit der Schirmvogtei belehnt, selber in Wartenstein ein. Auch der Nachfolger von Konrad II., Fürstabt Ludwig, vermochte der Willkür der Sax nicht zu entkommen und musste eine siebenwöchige Gefangenschaft auf der Burg Wartenstein erdulden.
Der Niedergang des Geschlechts liess nicht auf sich warten. Aufgrund einer er-drückenden Vielzahl von Interessen in allen Winkeln Graubündens und im Unterland sa-hen sich die Sax zur Verteidigung dieser Interessen in zahlreiche kostspielige Fehden verwickelt. Auch die unzähligen Vorstösse der Sax, Wartenstein vom Kloster Pfäfers käuflich zu erwerben (obwohl sie sich bereits im Besitz eines Dutzends Burgen wussten), trugen zur finanziellen Schieflage des Feudalgeschlechts bei. Schliesslich löste Abt Rudolf von Bernang die Herren von Sax mit einer ordentlichen Summe aus und Wartenstein gelangte im 14. Jahrhundert wieder in den ungestörten Besitz der Abtei. Als neue Schutzherren des Klosters nahmen die Herren von Wildenstein, obwohl bereits Eigentümer von Burg Freudenstein, während knapp zwei Jahrhunderten Wartenstein zur Residenz. Nachfolger der Wildenstein wurden die Werdenberg. Das protzige und gewalttätige Treiben der Werdenberg führte zum Entschluss des Abts, auf Schloss Wartenstein keine Schirmvögte mehr einzusetzen.


Die Eidgenossen
1483 gelangte das Sarganserland an die sieben alten eidgenössischen Orte. Sie übernahmen sogleich das Zepter und setzten im Schloss Sargans den eigenen Vogt ein, der seinen Herrschaftsbereich eigenmächtig auch auf die kleine Fürstabtei Pfäfers – den «staatlichen» Einflussbereich des Klos-ters, Ragaz und das Taminatal – ausdehnte. Verständlich deshalb die regelmässigen Dissonanzen zwischen den Äbten und den Eidgenossen der sieben alten Orte.
Unter dem Rapperswiler Johann Jakob Russinger, der als «Abt von Wartenstein» von 1517 bis 1549 das Kloster führte, erlebte Wartenstein eine letzte Blütezeit. Er erwählte die Burg, welche lange leer gestanden hatte, zu seinem Sitz, liess sie als «Gästeburg» für die Kurgäste der Pfäferser Therme einrichten und pflegte regen Kontakt mit Geis-tes-grös-sen der Reformationszeit, so mit Ulrich Zwingli, der 1519 die Therme als Kurgast besuchte, oder mit dem Mediziner Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 –1541), genannt Paracelsus, den er 1536 zur ersten wissenschaftlichen Begutachtung der Ther-me er-mun-terte. Paracelsus ist vor allem mit seinem Diktum «Allein die Dosis macht das Gift aus» bis heute bekannt.
Der Klosterbrand
Am 19. Oktober 1665 brannte das Kloster während eines heftigen Föhnsturms bis auf die Grundmauern nieder. Abt Justus Zink dankte verzweifelt ab, das Kloster Einsiedeln entsandte als neuen Abt den Luzerner Bonifaz Tschupp und versprach materielle Hilfe. In dieser Notsituation wurde Wartenstein bis auf die Grundmauern abgetragen und als Baumaterial zum Wiederaufbau des Klosters verwendet.
Jahrhunderte später beherbergte ein Chalet neben der längst zerfallenen Burg den Dichter Rainer Maria Rilke (1875–1926) für eine ers-te Badekur, der weitere geschätzte Aufenthalte in Bad Ragaz folgen sollten: «Hiersein ist herrlich», sub-sumierte er.

220 Pflanzenarten,2,5 Kilometer Trockenmauern, uralte Weinberge
Aus heutiger Perspektive beeindruckt die geschichtsträchtige Kul-tur-land-schaft der Porta Romana vor allem aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt und dem Reich-tum von Flora und Fauna. Eine Zählung am Kapellhügel von St. Geor-gen ergab 220 verschiedene Pflanzenarten. Die insgesamt 2,5 km langen und ökologisch besonders wertvollen Trockensteinmauern, welche den alten Römerweg säumen und die mit 720 Metern über Meer höchstgelegenen Rebberge der Ostschweiz gliedern, bilden Lebens- und Schutzräume für Moose, Flechten, Blütenpflanzen, Insekten und Reptilien wie Zauneidechse, Ringelnatter und Blindschleiche. Reichhaltig gestaltet sich auch die mit klangvollen Namen bestückte Liste von Schmetterlings- und Heu-schre-cken-ar-ten: Alpen-Strauchschrecke, Hauhechelbläuling, Klei-nes Wiesenvögelchen, Nachtigall-Grashüpfer oder Warzenbeisser.
In den sehr alten Rebbergen der Porta Romana, denen Quellen ein Bestehen seit der Römerzeit at-tes-tie-ren, werden die Sorten Blauburgunder, Müller-Thurgau und resistente Sorten wie Regent, Maréchal Foch und Léon Millot kultiviert. Daraus entstehen der traditionelle «Portaser» oder Varietäten wie Federweiss, Barrique oder Strohwein. Beim Letzteren werden die Trauben in einem Tenn auf 1200 Metern über Meer auf eine Strohunterlage gebettet, wobei die trockene Luft über der Nebelgrenze den Trauben besonders ideale Bedingungen bietet.
Aufwertung und Erhaltung der Porta Romana
Das abseits gelegene, stark naturnah gebliebene Paradies der Porta Romana erhält sich nicht von selbst und bedarf der Pflege. Beschädigte oder zerfallene Tro-cken-mauern sind neu zu erstellen, einwachsende Gebüsche, welche botanisch wertvolles Wiesland bedrängen, sind zu eliminieren. Rasch wachsende Eschen und Haselsträucher breiten sich in Wäldern und Hecken zulasten der Artenvielfalt aus.
Die Golf Natura Stiftung Bad Ragaz hat ein aufwendiges Projekt zur Erhaltung und Aufwertung der Porta Romana im Sinne eines ökologischen Ausgleichs für die Erweiterung des Golfplatzes lanciert. Diese Stiftung wird finanziell und ideell getragen durch die Grands Hotels Bad Ragaz. Die Gesamtkosten des Projekts werden bis zum Jahr 2012 auf 870 000 Franken geschätzt.
Unterstützung erfährt die Porta Romana mit dem Engagement des Fonds Landschaft Schweiz (FLS) auch vom Bund. Um anlässlich der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft «etwas von bleibendem Wert» zu schaffen, wurde der FLS 1991 durch die beiden Kammern des Parlaments gegründet. Er hat seither in allen Landesgegenden mit rund 105 Millionen Franken etwa 1500 lokale und regionale Projekte zur Erhaltung und Aufwertung naturnaher Kulturlandschaften mitfinanziert.


Mittelfluss und eigener Einsatz
Bis 2010, d. h. für die ersten vier Projektjahre, hat der FLS für das Projekt Porta Romana einen Beitrag von 100 000 Franken zugesagt. Diese Mittel sind vornehmlich für die Sanierung der alten Tro-cken-mauern bestimmt. Ausgeführt wird diese Arbeit durch die Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz (SUS) mit einem alljährlich dreiwöchigen Arbeitseinsatz durch zehn bis fünfzehn Zivildienstleis-ten-de, dies im Verein mit interessierten Grundeigentümern und der Forstgruppe Pfäfers.
Ebenso soll die Pflege der Magerwiesen, Hecken und Wälder von Grundeigentümern übernommen werden, welche im Gegenzug aber beraten und entschädigt werden. In einer ersten, naturgemäss besonders aufwendigen Phase unterstützt der Fonds Landschaft Schweiz die Wiesen-, Hecken- und Waldrandpflege. Sein Beitrag ist an die Auflage geknüpft, dass die spätere Pflege durch die Projektträger, Gemeinden und den Kanton sichergestellt werden soll.
Unterstützte Projekte
Im Verbreitungsgebiet der «Terra plana» wurden für die Erweiterung und Aufwertung naturnaher Kulturlandschaften fast 1,3 Millionen eingesetzt, so zum Beispiel für:
• Wiederbewässerung der Giessen im Sarganser Becken mit 257‘000 Franken
• Landschaftspflegeprojekt der Stiftung Pro Quinten mit 25‘000 Franken
• Pro-Natura-Projekt Kiesgrube Feerbach, Vilters, mit 50‘000 Franken
• Reaktivierung der Wartauer Giessen mit 89‘300 Franken
• landschaftliche und ökologische Aufwertung des Burghügels Wartau mit rund 252‘000 Franken
• Aufwertungsmassnahmen im Rahmen der Gesamtmelioration Sennwald mit ca. 53‘000 Franken
• ökologische Aufwertungsmassnahmen im Tüfmoos in Sennwald durch die Schweizerische Stiftung für Vogelschutzgebiete SSVG mit 50‘000 Franken
• das Erhaltungs- und Aufwertungsprojekt «Hütten – Gassen – Mauern – Waldränder» und ein Folgeprojekt am Grabserberg mit 140‘000 Franken
• verschiedene Projekte zur Pflege von Hochstamm-Obstbäumen, Bachläufen und Hecken in der Gemeinde Malans mit insgesamt fast 187‘000 Franken.
Im Kanton St. Gallen hat der Fonds Landschaft Schweiz bisher gegenüber 79 Projekten insgesamt 6,9 Millionen Franken zugesagt; im Kanton Graubünden wurden 13,5 Millionen Franken für 165 Projekte bereitgestellt.
Quellen
Langer-Würben, Bernd: Hiersein ist herrlich. Bad Ragaz 1982.
Rusch, J. B.: Geschichtliche Spuren rings um Bad Ragaz. Bad Ragaz 1960.
Sarganserland 1483–1983. Mels 1982.
www.fls-fsp.ch