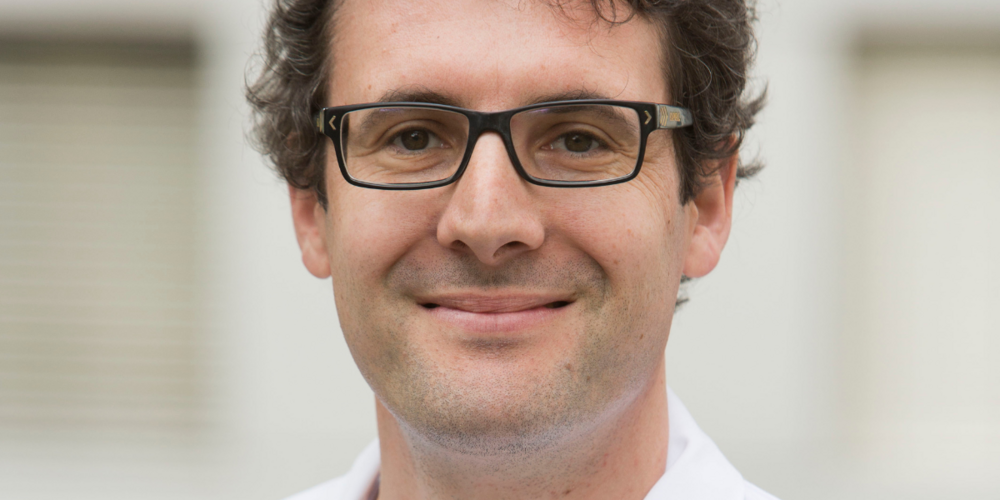Die meisten Krebspatienten sprechen zunächst gut auf ihre Therapien an. Mit der Zeit können sich jedoch Resistenzen gegen diese Therapien entwickeln, die dazu führen, dass die Behandlungen nicht mehr wirken. Dadurch wird die Krebserkrankung unkontrollierbar und der Krebs kann sich weiter im Körper ausbreiten. Die genauen Ursachen und wie solche Therapieresistenzen entstehen, sind noch nicht ausreichend verstanden.
250'000 Franken
Aus diesem Grund hat die Stiftung Swiss Bridge entschieden, die Ausschreibung des Swiss Bridge Award 2023 dem Thema Therapieresistenz bei Krebs zu widmen. Insgesamt haben sich 70 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa in diesem Jahr für den Award beworben. Eine mit angesehenenExperten besetzte Jury hat in einem zweistufigen Evaluationsverfahren schliesslich zwei Forschungsvorhaben den Vorrang gegeben.
Die Projektleiter, Anna Christian Obenauf vom Research Institute of Molecular Pathology in Wien und Lukas Flatz vom Kantonsspital St.Gallen, erhalten je 250’000 Franken für die Realisierung ihrer Forschungsprojekte.