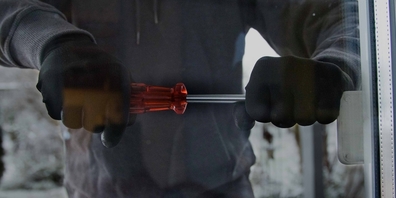Karl V., spanischer König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war 1528 hoch verschuldet. Beim Handelshaus der Welser hatte er sich viel Geld geliehen. Der König hatte jedoch kein Geld, das er zurückzahlen konnte. Deshalb gab er den Welsern das Recht, das Gebiet von Venezuela zu kolonisieren und auszubeuten.
Dafür brauchten die Welser Arbeitskräfte. Deshalb einigten sich der König und die Welser, 4000 versklavte Menschen aus Afrika in die Karibik und aufs amerikanische Festland zu verschleppen und dort den Siedlern zu verkaufen.
Ausgehandelt wurden diese Abmachungen von zwei Kaufleuten aus der Bodenseeregion, dem St.Galler Hieronymus Sailer und dem Konstanzer Ulrich Ehinger. Der Vertrag von 1528 über die Verschleppung und den Verkauf von 4000 Menschen gilt als zweitälteste Massenlizenz in der Sklavereigeschichte.
Auf dieser Basis begann damals der lukrative transatlantische Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika. Bis ins 19. Jahrhunderts wurden über 12 Millionen versklavte Menschen nach Amerika deportiert.
Ein Buch über neue Forschungen
Dass ein St.Galler Kaufmann namens Hieronymus Sailer im transatlantischen Sklavenhandel und der südamerikanischen Kolonialgeschichte mitmischte, war für das Team von Stadtarchiv und Vadianischer Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen neu. Von zwei Konstanzer Forscherinnen auf das Thema aufmerksam gemacht, starteten die Historikerinnen eine Recherche.
Im Buch «Konquistadoren und Sklavenhändler vom Bodensee. Kolonialgeschichte im 16. Jahrhundert» präsentieren sie ihre Forschungsergebnisse.
Die Autorinnen zeigen auf, dass Hieronymus Sailer, der in ganz Europa Geschäftsbeziehungen pflegte, auch privat vom Sklavenhandel profitierte. Er selbst war nie in Venezuela gewesen: Melchior Grübel, aus einer reichen St.Galler Handelsfamilie stammend, trieb als Konquistador auf dem südamerikanischen Festland gemeinsam mit seinem Sohn Leonardo die Unterwerfung der Einheimischen unter die Welserherrschaft voran, unternahm Feldzüge ins Landesinnere, war an der Gründung von Städten beteiligt und führte in den 1550er-Jahren sechs Landgüter, auf denen indigene Arbeitskräfte für ihn schufteten.
Hieronymus’ Neffe Michael Sailer profitierte in St.Gallen, Augsburg und Lyon vom Kontaktnetzwerk und den Handelskenntnissen seines Onkels, erwirtschaftete als Kaufmann ein grosses Vermögen und stiftete der Stadt St.Gallen Ende des 16. Jahrhunderts ein Schulhaus, das Sailer-Schulhaus.
Dieses Schulhaus an der Kugelgasse ist heute das einzige Gebäude in der Stadt, das namentlich und bildlich auf die Familie Sailer verweist. Über der Tür prangt das Sailer-Wappen, wie dies der Stifter, Michael Sailer, gewünscht hatte. Wurde das Schulhaus vielleicht auch mit Gewinnen aus dem Sklavenhandel bezahlt?